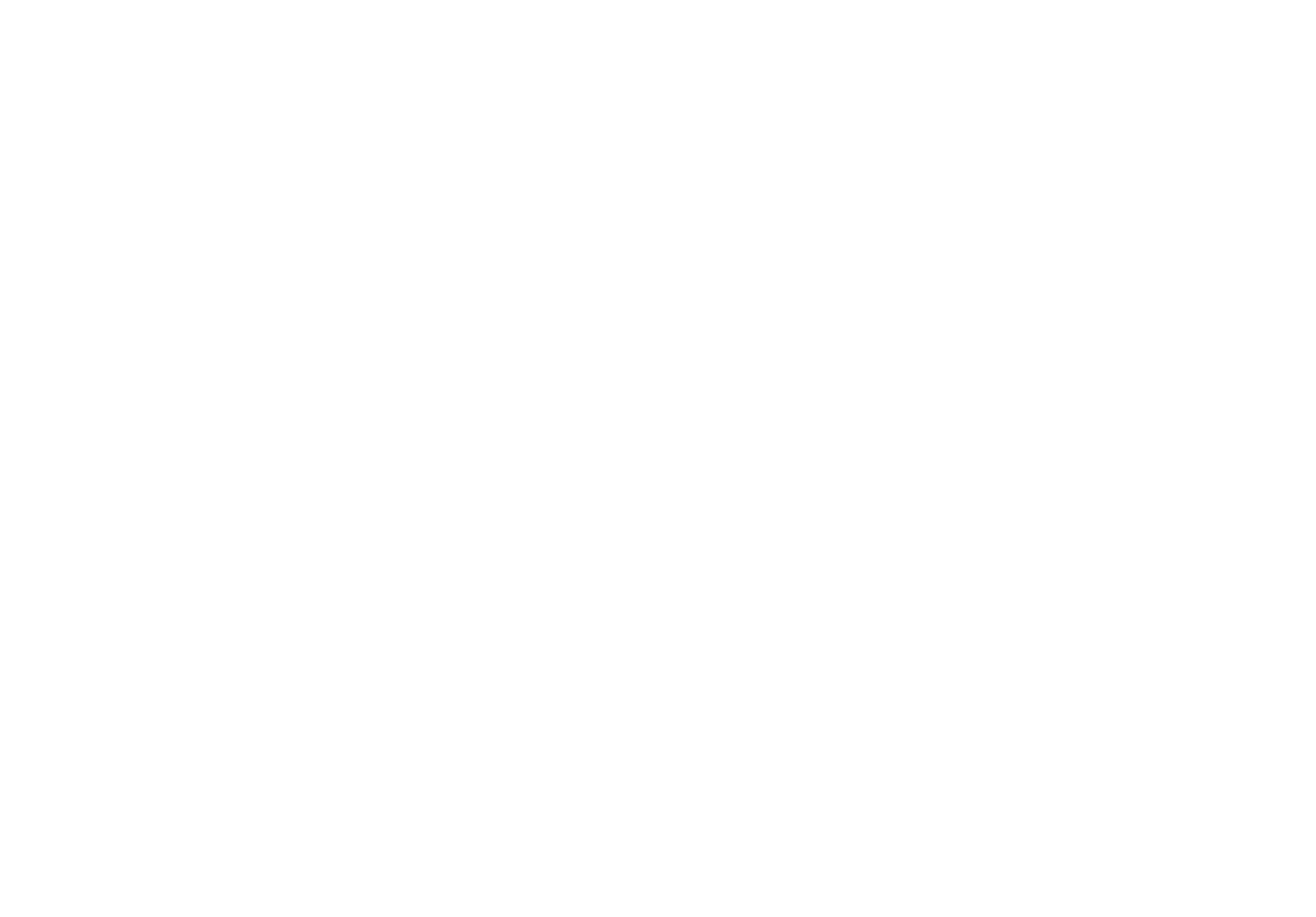Stille Stunde: Ein Zeichen für Rücksicht und Inklusion
Wir leben in einer schnelllebigen und zunehmend hektischen Welt, in der wir von Reizen teilweise regelrecht überflutet werden. Das stellt besonders für Menschen mit sensorischen Beeinträchtigungen wie Autismus-Spektrum-Störungen oder ADHS eine Herausforderung im Alltag dar. Für sie können laute Geräusche und grelles Licht zu großem Stress und Überforderung führen. Um ihnen ein angenehmeres Umfeld zu bieten, wurde das Konzept der "Stillen Stunde" ins Leben gerufen. Wir erklären, was genau sich dahinter verbirgt.
Zum Thema: Reizüberflutung
Reizüberflutung entsteht, wenn der Körper über die Sinne – also Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten – so viele Eindrücke gleichzeitig aufnimmt, dass das Gehirn sie nicht mehr verarbeiten kann. Diese Überforderung führt bei vielen Betroffenen zu starker innerer Unruhe, Stress oder sogar Zusammenbrüchen. Im medizinischen Kontext wird hierfür häufig der Begriff (sensory) overload verwendet. Besonders anfällig sind Menschen mit ADHS oder im Autismus-Spektrum. Bei ihnen kann eine scheinbar normale Alltagssituation zu einem sogenannten Meltdown (emotionaler Zusammenbruch) oder Shutdown (starker Rückzug) führen. Aber auch Menschen mit Multiple Sklerose, Migräne, Depressionen, Long Covid, Angststörungen, Demenz oder kognitiven Beeinträchtigungen können betroffen sein.
Was ist die "Stille Stunde"?
Die "Stille Stunde" ist eine Initiative, die darauf abzielt, wöchentlich für eine bestimmte Zeit Maßnahmen zu ergreifen, die einer Reizüberflutung entgegenwirken. Konkret geht es um den Einzelhandel: Supermärkte und andere Geschäfte können einiges tun, um Menschen mit sensorischen Empfindlichkeiten ein angenehmes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Dazu werden meist einmal pro Woche, zum Beispiel jeden Dienstag zwischen 15:00 und 17:00 Uhr, Reize bewusst reduziert.
Zu den Basis-Maßnahmen zählen:
- Möglichst gedimmtes Licht
- Keine Lautsprecherdurchsagen
- Keine Musik
- Keine lauten (Handy-)Gespräche
- Keine aktiven Displays
Darüber hinaus setzen viele Geschäfte auf Zusatz-Maßnahmen, um die Stille Stunde noch wirksamer zu gestalten:
- Reduzierte Geräusche an der Kasse
- Kennzeichnung von Angestellten zur Unterstützung
- Keine Warensortierung oder -verräumung während der “Stillen Stunde”
Grundsätzlich liegt es an den Betrieben selbst: Sie sind eingeladen, über die Basismaßnahmen hinaus eigene Lösungen zu entwickeln – je nachdem, was sie selbst leisten können und möchten.
Ursprung und Verbreitung der “Stillen Stunde”
Das besondere Konzept der "Stillen Stunde" hat seinen Ursprung in Neuseeland und wurde dort erstmals von Theo Hogg, einem Angestellten des Supermarkts Countdown und Vater eines autistischen Kindes, eingeführt. Die Idee fand schnell Anklang und verbreitete sich international. Auch in Deutschland setzen immer mehr Geschäfte bestimmte Maßnahmen um, um ein inklusives Einkaufserlebnis zu schaffen. Etwa haben die CAP-Märkte, die auch für ihre inklusiven Arbeitsplätze bekannt sind, in all ihren Filialen die "Stille Stunde" eingeführt. Während dieser Zeit werden Maßnahmen wie gedimmtes Licht, Verzicht auf Musik und Durchsagen sowie ein ruhiger Kassenbereich umgesetzt. Auch einige Edeka- und REWE-Märkte beteiligen sich.
Die "Stille Stunde" ist ein bedeutender Schritt hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Sie ermöglicht es Menschen mit sensorischen Beeinträchtigungen, alltägliche Aktivitäten wie das Einkaufen stressfreier zu gestalten. Zudem sensibilisiert sie die Öffentlichkeit für die Bedürfnisse dieser Personen und fördert das Bewusstsein für die Vielfalt menschlicher Wahrnehmungen. Hierzulande wurde das Konzept übrigens vom Verein "gemeinsam zusammen e. V." nach neuseeländischem Vorbild gegründet, um neurodivergenten Menschen zu helfen. Schirmherrin der Stillen Stunde ist die Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer (Bündnis 90/Die Grünen).
Fazit: Kleine Veränderungen mit großer Wirkung
Die „Stille Stunde“ ist mehr als nur ruhige Einkaufszeit – sie ist ein Symbol für Rücksichtnahme, Respekt und Inklusion. Sie zeigt: Es braucht nicht immer große Veränderungen, um Barrieren abzubauen. Schon einfache Maßnahmen wie das Dimmen des Lichts oder der Verzicht auf Musik können Menschen mit sensorischen Empfindlichkeiten spürbar entlasten und ihnen ein Stück Selbstständigkeit zurückgeben. Je mehr Geschäfte sich beteiligen, desto selbstverständlicher wird eine Umgebung, in der alle Menschen Platz haben.